Von der Reformidee zum Desaster

Zwischen 1759 und 1762 zog es über 4.000 Menschen aus dem vom Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763) verheerten Süddeutschland in den Norden. Sie folgten dem Ruf und den Versprechen des dänischen Königs Friedrich V. (*1723/1746-1766†). Als Kolonisten sollten sie die ausgedehnten Ödlandflächen der Geest der cimbrischen Halbinsel „unter Kultur bringen“. Doch statt einer Zukunft in Frieden und auf eigenem Land fanden die meisten Menschen aus dem wald- und weinreichen Süden nur „schwarzes Brot zu essen und Gottes Erdboden zu brennen“. Das große Projekt endete in einem Desaster. Als es 1765 eingestellt wurde, blieben von den geplanten 4.000 Siedlerstellen nur 600. Das Vorhaben der Agrarreform war damit gescheitert. Es war nicht gelungen, die Heide- und Moorflächen zu „peupliren“ (bevölkern). Ziel des merkantilistischen Vorhabens war es, die Steuereinnahmen zu erhöhen, um den teuren Hof und das stehende Heer des absolutistischen Herrschers zu finanzieren. Während die übrigen Agrarreformen des 18. Jahrhunderts – wie das Ende der Leibeigenschaft und der Übergang von der gemeinschaftlichen zur individuellen bäuerlichen Landwirtschaft durch die Verkoppelung – die soziale und wirtschaftliche Situation der Menschen auf dem Lande nachhaltig verbessert haben, scheiterte die Kolonisation gründlich.
Landesausbau der „Jütischen Heiden“
Es war der vierte Versuch, der 1759 auf Betreiben von Außenminister Johann Hartwig Ernst von Bernstorff (*1712 – 1772†) und – vor allem – durch Oberhofmarschall Adam von Moltke (*1710 -1792†) gestartet wurde. Schon 1723, 1751 und 1753 waren Projekte der Ödlandkolonisation kläglich gescheitert. Doch dieses Mal sollte es im großen Stil gelingen. Den Impuls gab der Kammeralist Johann Heinrich Gottlieb von Justi (*1717-1771†) in seinem „Gutachten wegen Anbauung der jütischen Heiden“. Von Justi empfand die über Jahrhunderte unbebauten Ödlandflächen auf dem Mittelrücken als ein Fanal des schlechten Zustands der dänischen Landwirtschaft im Allgemeinen. Die zu beheben schienen weder von der Erbfolge unberücksichtigte („weichende“) Bauernsöhne noch heimische Tagelöhner geeignet. Johan Frederik Moritz (1771†), dänischer Gesandter in Frankfurt am Main, empfahl, auf „versierte“ Landwirte aus Südwestdeutschland zu setzen. In „Oberdeutschland“ seien nach den Verheerungen des Siebenjährigen Kriegs viele ausreisewillig. Das gerade gegründete „Landwesenskollegium“ in Kopenhagen nahm sich der Sache an. Die Heidekolonisation sollte in Jütland beginnen. Moritz bekam den Auftrag, Kolonisten zu gewinnen. In Anzeigen warb er in der Pfalz, Baden, Württemberg und Hessen. Der dänische Staat versprach jeder Siedlerfamilie eine Erbpachtstelle mit Haus, Vieh, Ackergerät, 20 Jahre Steuerfreiheit, Tagegeld bis zur ersten ausreichenden Ernte und Reisegeld. Als erster verdiente der Gesandte. Vier Reichstaler bekam er pro Angeworbenen. Deshalb war er nicht wählerisch. Er akzeptierte fast jeden – auch Schwache und solche, die von Landwirtschaft nichts verstanden.
Die „Pfälzer“ kommen
Nach siebenwöchiger Reise trafen Oktober 1759 die ersten oberdeutschen Familien in Viborg ein. Ende 1760 waren es schon an die 1.000 Menschen. Im Norden wurden sie nur als „Pfälzer“ bezeichnet. Vorbereitet war wenig. Nach einem Winter in Notquartieren wurde erst 1760 den ersten Kolonisten Land auf der Alheide südwestlich von Viborg und der Randbølheide westlich von Vejle angewiesen. Das Vorhaben stieß schnell an seine Grenzen: Der schlechte Boden, ungeklärte Rechte und Proteste der Siedler wie auch der Einheimischen veranlaßten die Regierung bald, den Strom der Siedler nach Süden auf die schleswigschen Heiden umzulenken. Und damit wieder auf Ödländereien, die nach Ansicht von Bauern und Amtmännern im Herzogtum Schleswig nicht zu kultivieren waren. In Kopenhagen zweifelte man daran. Die Regierung schickte einen Gutachter auf die schleswigsche Geest. Der Arzt und Unternehmer Johann Gottfried Erichsen (*1712-1768†) hatte bereits in Jütland kolonisiert. Er lieferte ein optimistisches Gutachten: In den dänischen Teilen der Herzogtümer hielt er über 4.600 Siedlerstellen für möglich. Zu der nach heutigem Wissen völlig utopischen Zahl war Erichsen unter zwei Vorgaben gekommen. Einmal nahm er an, fast jede brachliegende Heide oder Moorfläche sei kultivierbar. Zum anderen rechnete er für jede Siedlerstelle auf der Heide nur neun, für die in Moorgebieten zwölf Hektar. Damit folgte er der verbreiteten Ansicht, nur kleine Flächen würden die Bauern zwingen, intensiv zu wirtschaften.
Siedeln nach Plan
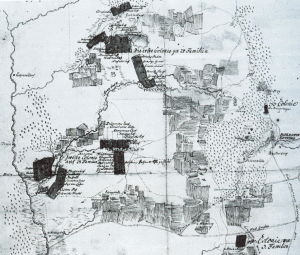
1761 wurde nach Erichsens Plan begonnen, die Oberdeutschen in den Ämtern Gottorf und Flensburg anzusiedeln. Es folgten Kolonien im Amt Tondern. Bis 1764 wurden es zusammen 47. Die kleinste „Am Königswege“ bei Schleswig, bestand nur aus einer, die größte, Friedrichsholm bei Hohn, aus 44 Siedlerstellen. Bei Heidestellen wurden nur die Flächen abgesteckt und die trockenen, polsterartigen Buckel, die Bulte, eingeebnet. Wesentlich schwieriger war es, Moorflächen (Moore) für die Siedler vorzubereiten. Erichsen nahm sich dieser Arbeit auf der größten Moorfläche selbst an. Nach seinen ersten Erfahrungen auf Seeland ließ Erichsen westlich von Hohn (heute das „Königsmoor“ und das „Hapshoeper Moor“) bis zum Winter 1760 durch 600 einheimische Tagelöhner ein 18 Kilometer umfassendes Netz von tiefen Kanälen anlegen. Damit entwässerte er über 2.500 Hektar. Entgegen seiner Absicht waren die Kanäle – anders als in Ostfriesland – aber nicht schiffbar, weil das weiche Moor dies nicht zuließ.
Haus und Hof als Startkapital

Auch in den Herzogtümern mußten die Kolonisten, einquartiert bei Einheimischen, warten, bis sie auf ihr Land konnten. Noch bevor die Höfe gebaut waren, zogen sie in Erdhütten, um damit zu beginnen, die durchweg armen Böden zu bearbeiten. Zu jeder Stelle gehörte ein Haus und ein „Kohlhof“ (Garten), der mit einer lebenden Hecke umfriedet wurde. Ausgestattet wurde jeder Hof mit zwei Ochsen für ein Gespann, einer Kuh, zwei Schafen sowie dem notwendigen Futter bis zur ersten Ernte. Dazu bekamen die Siedler eine Egge, einen Spaten und eine Hacke sowie Saatgut. Zur Grundausstattung aller Heidestellen gehörte auch ein Pflug. Die Moorkolonisten bekamen ihn erst, wenn sie das Land mit der Hacke „ackerreif“ gemacht hatten. Vier Ziegeleien entstanden in Hüsby, Engbrück, Friedrichsholm und bei Hohn neu, um genügend Steine für den Hausbau zu brennen. Nach einem standardisierten Muster wurden Häuser von acht mal zwölf Meter erstellt. Es handelte sich um schlichte niederdeutsche Fachhallenhäuser, die damit in weiten Teilen Schleswigs neben den dort traditionellen jütischen, quergeteilten Geesthardenhäusern Einzug hielten. Da deren Holzständerkonstruktion das schwere Reetdach frei trug, sparte man an den nicht tragenden Außenwänden und baute sie nur einen Ziegel stark. Von den sechs durch die senkrechten Holzrahmen vorgegebenen „Fächern“ zu je etwa zwei Meter wurden zwei für den Wohnteil mit Kammer und Küche abgeteilt. Nur mit einem wollten sich die Oberdeutschen nicht abfinden: Sie protestierten so lange, bis sie statt der damals im Norden üblichen offenen Feuerstelle mit Rauchabzug unters Dach Öfen eingebaut bekamen. Die Kolonistenhöfe gehörten damals deshalb zu den wenigen Bauernhäusern, die einen Kamin hatten. Die Bauten mussten vor allem preiswert sein. Doch zu schwaches Material und Pfusch führte schon 1762 zum Zusammenbruch vieler Häuser. Als Folge entstand ein verbessertes Typhaus.
Königliche Ortsnamen

Die ersten Kolonien sind bis heute an ihrem Namen zu erkennen. Mit ihnen sollte dem absolutistischen König und seiner Familie gehuldigt werden. Entweder wurden sie nach dem König Friedrich V. (z.B. Königshügel, Königsberge, Friedrichswiese), seiner Frau (Julianenebene), seiner Tochter (Sophienhamm) oder seinem Sohn (Christiansholm, Prinzenmoor) benannt. Den Namen der zuletzt entstandenen Kolonien ist anzumerken, daß der Stolz auf das Projekt geschwunden war. Sie heißen nüchtern noch Neubörm oder Westscheide. Auch die einzelnen Kolonistenstellen erhielten besondere Namen. Die erste hatte immer einen Bezug zu Gott: “Gottes Schirm“ (Königsberge) oder “Will’s Gott“ (Friedrichsholm). Andere wiesen auf die staatliche Symbolik hin, wie etwa “Drei Kronen“ (Friedrichsholm). Sie konnten auch das Land beschreiben, wie “Heidestelle“ (Friedrichsanbau) oder “Feucht Land“ (Sophienhamm). Auch königliche Beamte wurden bedacht: “Bernstorffs Hof“ (Friedrichsau). Andere Stellen hießen “Saurer Schweiß“ (Christiansholm), “Potatos“ (Königshügel) oder “Frauen Fleiß“ (Friedrichsanbau). Die zuletzt vergebenen Stellen erhielten jeweils nur noch schlicht Nummern.
Einheimische contra Kolonisten
Auch auf der schleswigschen Geest kam es wieder zu Spannungen. Die Einheimischen mußten mühsam überzeugt werden, bevor sie sich vom Ödland trennten. Schwieriger noch war es, die Einwände der Kolonisten auszuräumen. Sie fühlten sich getäuscht. Bei ihrer Ankunft 1761/62 waren noch keine Stellen eingerichtet, so dass sie in den umliegenden Orten untergebracht werden mussten. In den Ämtern Gottorf, Flensburg und Tondern warteten im Oktober 1762 insgesamt 3.725 Personen auf rund 900 versprochene Stellen. Juni 1763 wurde mit 3.808 Personen die höchste Zahl erreicht. War es schließlich so weit, daß die Parzellen ausgelost wurden, weigerten sich manche Kolonisten, sie auch in Besitz zu nehmen. Besonders angesichts des mageren und tiefgründigen Moorbodens, bestärkt noch durch die Einheimischen, in deren Augen der Boden nichts taugte, wurde oft besseres Land gefordert. Die Obrigkeit versuchte der Situation Herr zu werden. Sie verhängte Gefängnisstrafen gegen die Beschwerdeführenden. Zudem begann sie jetzt auch, Parzellen an Einheimische zu vergeben. Viele Oberdeutsche gaben darauf nach, um nicht ganz leer auszugehen. Trotzdem hörte die Unruhe unter den Kolonisten nicht auf. Geschürt wurde sie durch ständige Reibereien mit den Einheimischen. Deren Angst, die Siedler könnten ihnen Einnahmequellen nehmen, trieb sie zu allerlei Übergriffen. So wurden Torfstiche der Kolonisten zerstört, ihre frisch angelegten Gärten verwüstet, und es kam zu Schlägereien.
Die Pfälzer flüchten

Am Ende scheiterte das Projekt jedoch, weil die Höfe trotz alle Mühe die Kolonistenfamilien nicht ernähren konnten. Neben dem Gemüse in den Kohlhöfen sollten als anspruchslose Feldfrüchte Buchweizen, Roggen, Gerste, Hafer und die im Norden neuen Kartoffeln angebaut werden. Im ersten Jahr noch half die Asche der Brandrodung, um die notwendigen Nährstoffe in den Boden zu bringen. Schon im zweiten Jahr fehlte dieser Dünger, und die Erträge sanken. Einzig Buchweizen und Kartoffeln brachten dann noch geringfügig bessere Ernten. Viele verließen deshalb verzweifelt ihre Stelle. Um diese Flucht zu finanzieren, verkauften sie allen Verboten zum Trotz ihre Ausstattung oder nahmen sie mit. Weil sie alle König Friedrich V. hatten huldigen müssen und auch verpflichtet waren, auf ihrer Stelle zu bleiben, desertierten sie in den Augen der Obrigkeit. Die griff hart durch wie etwa im Fall „Prinzenmoor“. Zwölf von 16 Familien flohen dort 1764. Die Oberdeutschen versuchten, über das gottorfische (Gottorfer) Norderdithmarschen per Schiff die Herzogtümer zu verlassen. Sie wurden jedoch gefaßt, ein Teil mußte beim Festungsbau in Rendsburg harte Karrenstrafe auf sich nehmen, ein anderer wurde ausgewiesen, der Rest auf neue Stellen gesetzt. Zur Flucht verleiteten die Pfälzer auch Flugblätter aus Preußen und Rußland, die ihrerseits um Kolonisten warben und mehr und besseres versprachen, als Dänemark ihnen geboten hatte. Die Regierung setzte darauf verstärkt einheimische Bewerber auf die frei werdenden Stellen. 1762 schon war jede weitere Anwerbung von Kolonisten gestoppt worden. Ein Jahr später begann die Obrigkeit, die Kolonisten zu prüfen und faule oder unfähige auszumustern (zu “kassieren“). 107 Kolonistenfamilien im Amt Gottorf, 80 im Amt Flensburg und 66 im Amt Gottorf wurden kassiert, darunter auch Reservekolonisten. Darüber hinaus verließen viele freiwillig ihre Stellen, die darauf neu besetzt wurden. Obwohl die ausgemusterten Familien das Recht hatten, zu bleiben und dafür 20 Taler als “Startkapital“ bekamen, verließen die meisten das Land. 1764 befanden sich hier nur noch 654 oberdeutsche Familien mit 2.855 Personen.
Die Gründe des Scheiterns

Obwohl durch straffere Kontrollen noch einmal versucht wurde, das Projekt zu retten, wurde immer deutlicher: die Kolonisation würde in einem Desaster enden. Die Gründe dafür suchten die Verantwortlichen in Kopenhagen im Unwillen und Unvermögen der Siedler. Doch die Ursachen lagen im Kern in den schlechten Heide- und Moorböden. Sie waren mit den Kenntnissen und Hilfsmitteln der Zeit nicht zu kultivieren. Den Kolonisten fehlte vor allem Dünger. Das war im 18. Jahrhundert vor allem Viehdung. Doch um Mist zu erzeugen, benötigte man Grünland. Um den Streit mit den Einheimischen nicht zu schüren, war es den Kolonisten nicht erlaubt, das von den angrenzenden alten Dörfern gemeinschaftlich als Allmende genutzte Weideland zum Gräsen und zur Heuwerbung zu nutzen. Erichsen empfahl deshalb, den in den Kohlhöfen anfallenden Abfall an das Vieh zu verfüttern und mit Kompost zu düngen. Der reichte allerdings nicht. Auch war es schwierig für die Kolonisten, die Moorböden durch Sand zu lockern. Ein zentrales Problem auf den Heiden war auf vielen Flächen die steinharte Schicht etwa einen halben Meter unter der Oberfläche. Dieser Ortstein hatte sich nach der letzten Eiszeit durch ausgewaschene Nähr- und Humusstoffe gebildet. Nun verhinderte er die Bildung von Humus und das dafür erforderliche Durchwurzeln des Sandes. Erichsen wußte um dieses Problem. Er forderte deshalb von den Kolonisten, bis zum Ortstein zu graben und die Schicht mit der Spitzhacke zu zerkleinern und zu verteilen. Den Nachweis, dass die Kolonisten vor einer weitgehend unlösbaren Aufgabe standen, erbrachte Projektleiter Erichsen schließlich selber. Nachdem die Kritik immer lauter wurde, hatte er sich einen „Probehof“ in einer Moorkolonie zuweisen lassen. Erst als er für viel Geld Tagelöhner angeheuert hatte, um den Boden durch Sand und Mergel zu verbessern, stellten sich zumindest auf Teilflächen Erfolge ein. Die Methode war aber für die Kolonisten schlicht zu teuer. Einen aufschlußreicheren Versuch unternahm der bei der Session des Amts Flensburg beschäftigte Hausvogt Lüders. Er bewirtschaftete in der Kolonie „Königshöhe“ ebenfalls eine Musterwirtschaft. Erst als er Wiesen für die Produktion von Dung dazu pachtete, stellte sich dort Erfolg ein. Allerdings verschlang die Pacht für das zusätzliche Grünland den Gewinn wieder.
Das Ende des Projekts

Nachdem Lüders‘ Erkenntnisse der Regierung bekannt geworden waren, verlangte sie Ende 1764 von den „Koloniesessionen“ genaue Berichte. Sie fielen niederschmetternd aus: Von den 408 Gottorfer Stellen wurden 254 als schlecht, 52 als mittelmäßig und nur 111 als gut beurteilt. In den Ämtern Tondern und Flensburg böten nur ganz wenige Stellen gute Möglichkeiten, die meisten hätten keine Aussichten auf Erfolg. Überall mangele es an Dünger. Um den Kolonien zu helfen, sei eine Summe von 81.000 Talern im Jahr 1765 notwendig. Von der Ansiedlung der noch wartenden 82 Kolonistenfamilien rieten die Sessionen durchweg ab. Die enorme Summe von 412.000 Taler hatte der dänische Staat bis dahin schon – im Sinne des Wortes – in den Sand gesetzt. Deshalb wurde entschieden, keine neuen Kolonien mehr anzulegen und die bestehenden nach kurzer Übergangszeit sich selbst zu überlassen. Nachdem die zugesagten Tagegelder ausgezahlt waren, blieb den Kolonisten als einziges Privileg nur die 20 steuerfreien Jahre. Von den prognostizierten 4.000 Stellen waren nur um die 600 angelegt worden, von denen knapp 500 dauerhaft bestehen blieben.
Späte Lösungen
Die verbliebenen Kolonisten schlugen sich mehr schlecht als recht durch. Zumindest für die Moorsiedler gab es mit dem Handel mit Torf für den Hausbrand, Glasschmelzen (Prinzenmoor und Friedrichsholm) sowie der Ziegelei in Friedrichsholm die Chance für ein Zubrot. Nach dem abrupten Ende waren einige Kolonien zu Teilen der alten Gemeinden worden. Sie durften damit auch die Almende als Weide mitbenutzen und erhielten im Zuge der Verkoppelung dadurch ihren eigenen Anteil daran. Damit entspannte sich dort das Düngerproblem. Gelöst wurde er erst, als im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts der neue „Kunstdünger“ (Mineraldünger) besser und preiswerter verfügbar wurde, von 1893 an Dampfpflüge auf großen Flächen den Ortstein aufbrachen und Preußen staatlich die Bodenverbesserung, die Melioration, vorantrieb. Die Maßnahmen griffen erst um 1900 und brachten damit das bis dahin weitgehend brachliegende Kolonistenland langsam in Kultur. Nach den Landverlusten im Osten in Folge des Ersten Weltkriegs intensivierte die 1913 gegründete Landgesellschaft die Ödlandkultivierung. Bis 1939 bewies sie, wie groß das Potential in Schleswig-Holstein war, wenn man moderne Technik nutzte. 6.600 neue Siederlerstellen mit 91.000 Hektar entstanden. Nach der Machtübernahme 1933 wurde die Ödlandkultivierung durch die Nationalsozialisten propagandistisch genutzt. Reichsarbeitsdienst und Arbeitslose sollten – mit übrigens meist vorindustriellen Methoden – neuen „Lebensraum“ schaffen. Die Landwirtschaft auf den ehemaligen Heide- und Moorflächen der Geest blieb jedoch mühsam und arm. Erst mit der Flurbereinigung, einem flächendeckenden Windschutz für die erosionsanfälligen leichten Böden sowie der konsequenten Umstellung auf Weidewirtschaft seit 1953 im Rahmen des Programms Nord bekam auch die Landwirtschaft auf der schleswigschen Geest für die nächsten Jahrzehnte eine tragfähige wirtschaftliche Grundlage.
Jürgen Hartwig Ibs (TdM 0204/0404/0721)
Quellen: Christian Voigt, Die Kolonisierung der schleswigschen Heiden, 1760-65, in: ZSHG Bd. 26, 1896, S. 209ff.; Otto Clausen, Chronik der Heide- und Moorkolonisation im Herzogtum Schleswig (1760-1765), Husum 1981; H. Sievers, Die Moorkolonien in der Hohner Harde, in: Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Rendsburg, 1957, S. 132ff.; Heimatbuch des Kreises Rendsburg, Rendsburg 1922, S. 771ff.; Christian Degn, Die Heide- und Moorkolonisation auf der schleswigschen Geest, GSH , Bd. 6, Neumünster 1960, S. 227ff.; Jürgen H.Ibs/Björn Hansen/Olav Vollstedt, Historischer Atlas Schleswig-Holstein – 1867 – 1954, Herausgeber Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 2001, Neumünster, erschienen bei Wachholtz, ISBN 3-529-02446-5; Christian Degn/Uwe Muuß, Topographischer Atlas Schleswig-Holstein, herausgegeben vom Landesvermessungsamt, 3. Auflage, Neumünster, 1966, Wachholtz-Verlag; Ulrich Lange (Hrsg.), Geschichte Schleswig-Holsteins – Von den Anfängen bis zur Gegenwart (SHG), 2. verbesserte und erweiterte Ausgabe, Neumünster 2003, Wachholtz Verlag, ISBN 3-529-02440-6
Bildquellen: Heide: Ditmarscher Museum für Vor- und Frühgeschichte in Heide; Karte 1762: SH Landesarchiv Schleswig (LAS); Haus: SH Freilichtmuseum Molfsee; Meßtischblatt: Landesvermessungsamt; Bettelnde/ Kartoffeln: aus Otto Clausen s.o; Karte: aus Christian Degn, SH eine Landesgeschichte – Historischer Atlas, Wachholtz 1995