
Die „Kontinentalsperre“ wurde am 21. November 1806 in Berlin vom französischen Kaiser Napoleon Bonaparte (*1769/1804-1821†) verhängt. Die Blockade sollte alle wirtschaftlichen und menschlichen Kontakte zu Großbritannien beenden. Nur drei neutrale Länder waren nicht betroffen. Es waren die USA, Portugal und Dänemark. Dort profitierte schon seit der Blockade der Elbe durch die Briten seit 1803 das kleine Tönning an der schleswig-holsteinischen Westküste. Der Boom dauerte bis 1807, als Dänemark seine Neutralität aufgab und sich mit Frankreich verbündete. Bis zum Ende der Kontinentalsperre am 14. Januar 1814 mit dem Kieler Frieden wurde das 1807 von den Briten eroberte Helgoland zum Stapelplatz und Schmuggelzentrum nicht nur für Kolonialwaren aus den überseeischen Kolonien Englands.
Ende und Anfang von Scheinblüten
Im Zuge der napoleonischen Eroberungsfeldzüge profitierte als erstes im Norden Hamburg. Weil die belgischen und niederländischen Häfen nicht mehr zu erreichen waren, lief der britische Handel einige Jahre weitgehend nach Hamburg sowie ins dänische Altona und bescherte der dortigen Wirtschaft einen ordentlichen Schub. Das endete im Juli 1803 mit der Blockade der Elbe durch die Briten, die zwischen Oktober 1805 und April 1806 unterbrochen bis Oktober 1806 durchgehalten wurde. Nun übernahm das kleine Tönning. 1802 hatte das Städtchen am Westende des Schleswig-Holsteinischen Canals mit seinem großen Packhaus am Hafen 1.940 Einwohner, in den Jahren 1803 bis 1805 dann 6.000. Das waren jedoch nur die Einwohner mit Wohnrecht. Dazu kamen Seeleute, Händler und der Tross derjenigen, die dem schnellen Geld hinterherzogen. Weil der Raum bald nicht ausreichte, entstanden Pfahlbauten für Gaststätten, Bordelle und ein Theater. In Tönning schnellten die Mietpreise in bisher unbekannte Höhen, auch die Kosten für die Lebenshaltung wuchsen ungemein. Wer nicht am Boom verdiente, stürzte ab in die Armut.
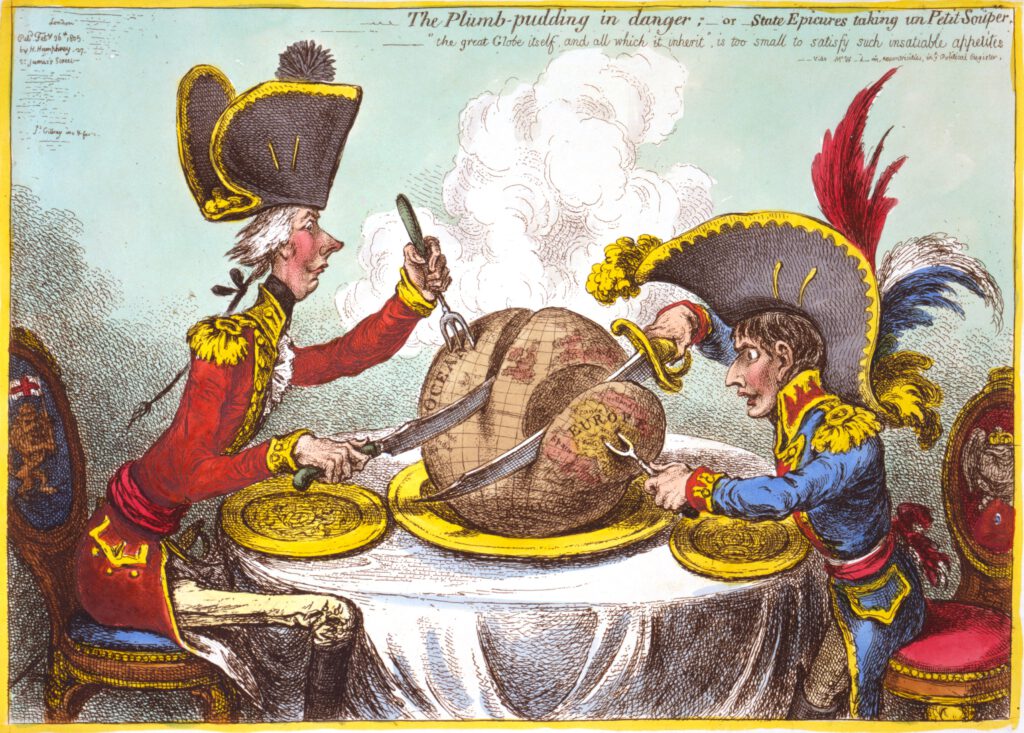
Tönning wird britisch
Als sich der Zustrom britischer Waren von Hamburg nach Tönning verlagerte, zogen auch viele britische Kaufleute von der Hansestadt nach Eiderstedt. England und Amerika hatten dort Vizekonsuln als diplomatische Vertreter, es gab sogar ein britisches Postamt. Das wurde von 1803 bis 1806 nach Husum verlegt, weil Tönning so überlaufen war, dass es für die Passagiere der regelmäßig verkehrenden britischen Paketboote keine Herbergen an Land bot. Leiter der englischen Poststelle war ein Mr. Harwood, der auch im Verdacht stand, für die Briten zu spionieren. Spionage und Gegenspionage waren ein Thema in der ersten Tönninger Boomzeit. Wie wichtig die kleine Stadt nun für das Vereinigte Königreich war zeigt sich daran, dass fast alle Zeitungen in Großbritannien Nachrichten unter der Rubrik „Tonningen Mail“ abdruckten.
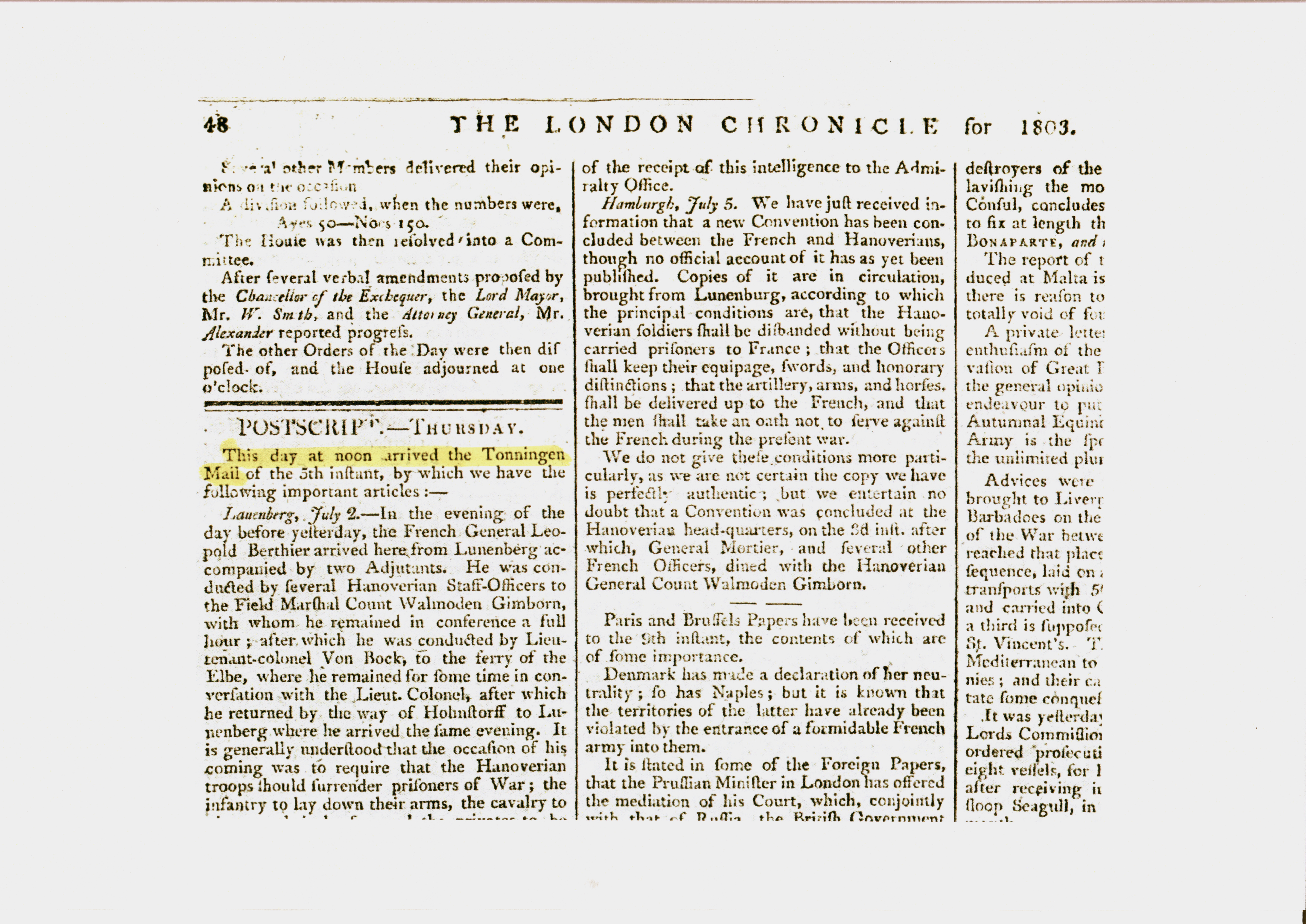
Weltverkehr im Eiderschlick
1805 registrierten die Listen des Schiffsversicherers Lloyd in London Tönning 800 mal als Anlege- oder Abfahrtshafen. Da die Eider ein schmales und gewundenes Tidegewässer ist, kamen nur kleinere Schiffe direkt in die Stadt zum Hafen am Packhaus. Alle Schiffe mit über 150 Kommerzlasten (eine Kommerzlast ist in etwa eine Wagenladung) mussten eiderabwärts auf Reede ankern. Die größeren Schiffe lagen meist vor Vollerwiek, wo die Eider breiter und tiefer ist. Vor der Eider kontrollierte eine dänische Fregatte. In Tönning hatte sich eine „Quarantänekommission“ gebildet, die einlaufende Schiffe und auch Personen kontrollierte, um zu vermeiden, dass Krankheiten eingeschleppt und verbreitet wurden. Da viele Schiffe aus überseeischen Gebieten kamen, war dies eine wichtige Maßnahme. Da in dieser Zeit auch die Kaperfahrt weit verbreitet war, kamen die Schiffe oft im Konvoi über die Nordsee aus England. Kolonialwaren und Tuche, die in ganz Europa hochbegehrt waren, kamen nach Tönning. Zurück gingen meist Lebensmittel.
Schleichhandel
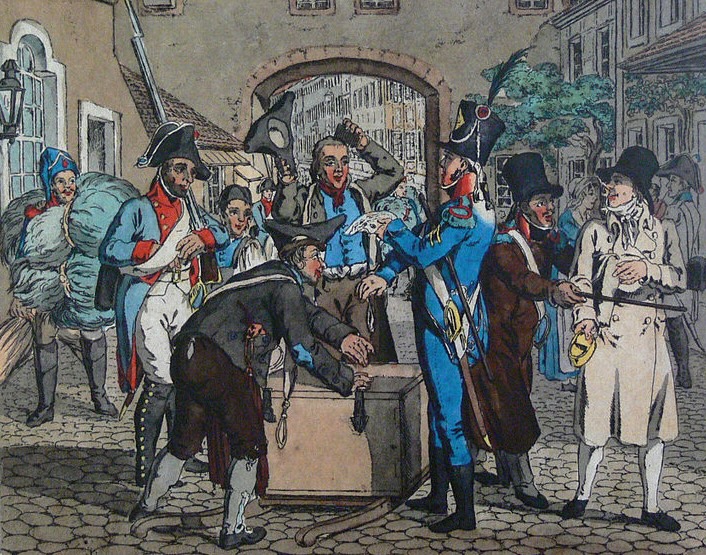
Solange Dänemark neutral war, konnte der Gesamtstaat ohne Probleme mit den Gütern aus England und seinen Kolonien versorgt werden. Auch profitierte Dänemark durch Wegezölle und andere Abgaben. Schwieriger war der Handel mit dem französisch beherrschten Rest Europas. Einmal fuhren ohne Unterbrechung Fuhrwerke von Tönning in das dänische Altona, wo die Güter dann bei Nacht und Nebel oder unter Röcken und in Ärmeln über die Straße vom dänischen Altona ins zwischen 1806 und 1814 französisch besetzte Hamburg wechselten. Weil die Blockadeschiffe mit ihrem Tiefgang in der Elbe nur die Flussmitte befahren konnten, schlüpften große Menge an Waren mit sogenannten Schlickrutschern an den Sperren vorbei in den Süden. Andere Wege führten über den Schleswig-Holsteinischen Canal oder die Stör. Auch wurden große Mengen von Waren umetikettiert. Aus Zucker aus der englischen Kolonie Jamaika wurde dann amerikanischer Zucker. Auch galt zum Beispiel der französische Konsul in Hamburg Louis Antoine Faulvelet de Bourrienne (*1769-1834†) als empfänglich für Bestechung und ermöglichte so die Einfuhr britischer Waren. Sowohl Frankreich als auch England lockerten ab und an die Blockade und erlaubten organisiert Schmuggel, wenn dringend Waren im eigenen Land benötigt wurden.
Bomben auf Kopenhagen
1807 nahmen die Spannungen zwischen Dänemark und Großbritannien zu. Es ging einmal um die Frage, ob das Königreich mit den Franzosen oder Engländern koalieren wollte. Zum anderen verfügte Dänemark nach England über die zweitgrößte Flotte. Die Briten forderten im August 1807 deren Übergabe. Als das nicht passierte, bombardierte die britische Flotte am 4. September 1807 Kopenhagen. 2.000 Menschen starben, ein Teil der Stadt brannte ab, die eigene Flotte wurde verloren und Dänemark verbündete sich mit Frankreich.
Helgoland übernimmt

Dänemark war nun nicht mehr neutral, die Engländer im Land plötzlich unerwünscht und verfolgt, und Tönning nicht mehr das Tor für den britischen Handel auf das Festlandseuropa. Die britische Zeit endete am 16. August 1807 mit einem Wettrennen zwischen einem englischen Paketboot und dem Wachschiff. Weil Flaute herrschte, wurde es mit Ruderbooten hinter dem Paketschiff hergezogen. Im letzten Augenblick kam etwas Wind auf und nach einem kleinen Geplänkel konnte das englische Schiff in die Nordsee entkommen. Die Briten sorgten schnell für Ersatz für Tönning. Am 5. September 1807 eroberten sie, ohne einen Schuss abzugeben, das bis dahin dänische Helgoland. Nun wurde die Hochseeinsel zum Stapel- und Handelsplatz für den Schmuggel ins kontinentale Europa. Statt vier Händler gab es bald 140 auf der Insel. Auch aus Tönning kamen einige der Engländer und ließen sich nun auf Helgoland nieder. Der Boom für die Insel endete nach sieben Jahren mit dem Ende der Kontinentalsperre.
Tönninger Nachspiel
Im Gegensatz zu den Briten waren die Amerikaner noch neutral. Und sie sprachen Englisch. Als die Verfolgung der Briten in Dänemark einsetzte, gaben sich einige als Amerikaner aus. Auch britische Schiffe wechselten vom Union Jack zu den Stars and Stripes. Der Schmuggel und Schleichhandel über Tönning ging also weiter, allerdings auf einem nun reduzierten Niveau. Da den Amerikaner verweigert wurde, nach Hamburg zu fahren, war wieder Tönning der Ausweichhafen. Allein 1809 legten 200 amerikanische Schiffe in Tönning an. Nicht alle waren echte Amerikaner oder hatten ihre Waren in England geladen, was verboten war.
1814 ist alles vorbei
Mit dem Ende der Kontinentalsperre endet auch die Boomzeit für Helgoland und Tönning. Beide sollten jedoch im 19. Jahrhundert einen zweiten Boom erleben. Der begann auf der Insel 1826 mit der ersten Badeanstalt und dem Einstieg in den Fremdenverkehr. Auch Tönning wurde erneut reich. Dieses Mal durch den Export von Rindvieh nach England. Zwischen 1846 und 1888 wurde über eine Million Stück Vieh in Tönning verladen.
Werner Junge (0201 / 0721/ neu 1025*)
Quelle: Elisabeth Kaack, Die Zeit der ‚Engländer‘ in einer kleinen Stadt an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste im 19. Jahrhundert“, 2. Aufl. Husum 2024, Husum; Elisabeth Kaack, Tönning und die Briten während der Napoleonischen Kriege, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Tönninger Stadtgeschichte Heft 38, 2020, S.10-22.
Bildquellen: Vignette/Ansicht Tönning: Stadtarchiv Tönning; Plum-Pudding: gemeinfrei Wikipedia; Tonningen Mail: British Newspaper archive; Leipziger Kriegsszene von Gottfried Heinrich Geißler 1824: gemeinfrei Wikipedia; Helgoland: Archiv Nordfriisk Institut.